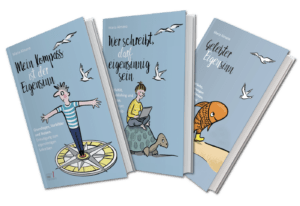Es gab Zeiten, da hatte ich mindestens 20 verschiedene Literaturmagazine in meinem Jugendzimmer rumliegen. Gelesen habe ich sie natürlich auch. Es ging darum, im Gespräch zu bleiben. Sich zu informieren, Diskussionen zu verfolgen, Standpunkte kennenzulernen. Ja, es ging oft auch um gesellschaftliche, politische, soziale. Zusammenhänge. Hat mich immer interessiert. Weil ich noch heute gern über Tellerränder, gucke, scheinbar Disparates miteinander in Bezug setze. Das gehört zu meiner Weltsicht. Und ich denke, ich habe das damals über die Auseinandersetzungen in und mit Literatur gelernt. Damals? Ja, ist wirklich lange her … rund 40 Jahre
Es war aufregend. Von der Literatur bin ich nahtlos zur Musik gewechselt … Punk und Popmusik … Elektro und New Wave. Da gab es beispielsweise eine Musikzeitschrift, in der auch Literatur und aktuelle Musik miteinander in Bezug gesetzt wurden. Der Kulturwissenschaftler, Kritiker, Journalist, Autor und Essayist Diedrich Diederichsen war einer meiner Helden … Er begann zum Beispiel eine Zeitlang jeden Artikel mit einem literarischen Zitat – völlig gegen alle Zitatregeln. Hat mich derart fasziniert, dass ich eine Zeit lang selbst so geschrieben habe: Nimm ein Thema in den Blick und folge deinem Gefühl – welche Assoziationen kommen dabei auf? Setzt in aller Regel auch ein gutes Gedächtnis und natürlich Literatur-Grundwissen voraus … (Hat das heute, dank KI, noch jemand?)
Ja, diese Art des Schreibens gibt es auch heute noch. Nur ist sie heute meist Bestandteil von „kreativem Schreiben“ und folgt dabei eigenen Regeln. Leider gehört es auch dazu, dass so etwas meist nur in abgeschlossenen Räumen, Zirkeln Seminaren und Kursen stattfindet … Öffentlichkeit fast immer unerwünscht.
Diskussionskultur und Mitreden-Wollen
Der Unterschied zu der Zeit, von der ich hier rede ist, dass dieses – nennen wir es mal „offene Schreiben“ – damals, zumindest in meiner Erinnerung, offener, weiter verbreitet, in manchen Gruppen schlicht selbstverständlich war. Jede:r konnte sich auf seine Weise in eine – gern auch absichtlich kontrovers gehaltene – Diskussion einklinken. Auf seine oder ihre Weise, mit exakt den Aspekten, die im Moment gerade richtig erschienen. Kaum Formzwänge, nur auf Inhalte und Positionen kam es an. Unterstützt wurde so etwas selbstverständlich von all den Literatur- und auch Musikzeitschriften. Oft sehr, sehr kleine Projekte, manchmal auch nur fotokopiert – wie später die berüchtigten Fanzines. Wichtig finde ich: Es gab einen Markt dafür. Es war Kultur in dem Sinn, dass so etwas allen offenstand. Wurde häufig nachgeahmt, etwa von Stadtmagazinen, die eine ähnliche Philosophie hatten. Von denen existiert im deutschsprachigen Raum mittlerweile vielleicht noch ein Dutzend – in den 80erJahren war es ein Vielfaches davon.
Und auf der nächsten Stufe gab es Feuilletons, in allen Tageszeitungen, oft noch verdoppelt durch „Regionales“ und „Überregionales“. Ich habe selbst als Journalistin in den Nullerjahren erlebt, wie das regionale Feuilleton einer großen Tageszeitung erst von einer ganzen auf eine halbe Seite zusammenschrumpfte und schließlich völlig verschwand. Feuilletonist*in war ein anerkannter Beruf. Und es gab Kolleginnen und Kollegen, die sich wirklich ihre ganz eigene Position erarbeitet haben. Die Kolumnen und Glossen schrieben über das literarische Geschehen – aus allen nur erdenklichen Perspektiven. Die wirklich eine Stimme hatten. Die wiedererkennbar waren. Und über die man sprach. Man sprach über sie und man sprach über die Autorinnen und Autoren, über die sie berichteten. Über Bücher und Neuerscheinungen, über Themen und Themen-Verwandtschaften, über gesellschaftliche Aspekte innerhalb eines Buches. Und das auf sehr breiter Ebene. Das interessierte viele Menschen, war manchmal kontrovers und diente oft auch einfach dem „Mitreden-Können! Okay: Ich gebe zu: ich habe zu der Zeit Germanistik studiert … Natürlich hat mich das damals schon in eine gewisse „Blase“ katapultiert. Aber ich bin sicher: Das allgemeine Interesse an literarischen Themen war wesentlich breiter gestreut als heute – viele Menschen konnten und wollten gern mitreden. Und: Niemand sprach über die neue Freundin von Autor XY, über die Scheidung von Weißnichtwem.
Dass mittlerweile sogar die Kultursendungen im Fernsehen immer seltener werden, ist ebenso wenig ein Geheimnis wie, dass in jeder Tageszeitung der Sportteil grundsätzlich sehr viel umfangreicher sein muss als der Kulturteil. Natürlich wird heute manches über das Internet aufgefangen. Ja, es gibt großartige Buchbloggerinnen und Buchblogger. Und trotzdem behaupte ich: Diese Welt ist abgezirkelter als das, was ich vor etwa 40 Jahren an Diskussionskultur erlebt habe.
Ich will ja gar nicht so viel jammern und scheinbar schramme ich auch noch an meinem eigenen Thema vorbei … Das soll ja eigentlich Buchmarketing sein. Darum versuche ich, den Blick ein wenig umzudrehen:
In einer lebendigen Diskussionskultur entsteht Marketing wie unabsichtlich nebenbei.
Indem ich über bestimmte Buchtitel rede, sie in Bezug zu anderen Büchern setze. Indem ich Standpunkte von Autorinnen öffentlich hinterfrage, indem ich gesellschaftliche Realitäten zu Buchwelten in Bezug setze, mache ich ja immer auch Werbung für das jeweilige Buch- im Positiven wie im Negativen.
Amazon-Bewertungen sind kein Buchmarketing
Ich war noch nie Fan der Buchkritik in dem Sinn, dass ich einen öffentlichen Verriss schreibe … um ja, um was zu erreichen? Die Frage habe ich mir oft gestellt, als ich noch Teile meines Einkommens über Buchrezensionen erhalten habe. (Ja, ich wurde tatsächlich mal dafür bezahlt!) Stand immer auf dem Standpunkt, dass das, was ich da schreibe, nützlich sein soll. Darum habe ich mich gefragt: Was nützt es, wenn ich den Menschen erzähle, was sie NICHT lesen sollen? Viel nützlicher sind doch konstruktive Empfehlungen. Daran habe ich mich gehalten.
Und wurde natürlich von der Realität der „Buchbewertungen“ auf Amazon völlig überrollt … Darum ist dies für mich absolut kein Ort für Buchmarketing. Denn als Autorin habe ich da ja nullkommagarnichts in der Hand! Ich bin ausgeliefert – und zwar einer Kultur, die im Internet nicht unbedingt freundlicher wird, wenn die öffentliche Diskussion meines Buches – im Sinn von Buchmarketing – die Amazon-Bewertungen sein sollen. Darum sage ich: Das ist kein Ort für Buchmarketing. Diskussionskultur? Fehlanzeige!
Wenn schon keine Diskussionskultur, sollte ich wenigstens als Autor*in die Chance haben, mein Buchmarketing so zu steuern, dass es meinem Buch und dessen Thema gerecht wird.
Sträfliche Vernachlässigung der Presse-Ethik
DIE Öffentlichkeit gab es sowieso niemals. Obwohl ich vermute: Es war vor 40 Jahren leichter, eine große, allgemein akzeptierte Öffentlichkeit beispielsweise über Feuilletons oder Literatursendungen zu erreichen. Und das liegt – leider – nicht nur an der fehlenden Diskussionskultur. Sondern auch an einer sträflichen Vernachlässigung einer noch immer gültigen Presse-Ethik. Die besagt nämlich unter anderem: Zwischen Redaktion und Anzeigenabteilung darf es keine Absprachen nach dem Motto geben „Wer hier dicke, teure Anzeigen schaltet, bekommt auch redaktionell nette Worte zu seinem Buch.“ Nein! Ist ein No Go. Eigentlich …
Es begann schleichend. Und erscheint heute viel zu vielen Menschen völlig „normal“, dass diese „Verschränkung“ von Redaktion und Anzeigeneinnahmen allenthalben geschieht. Niemand prangert es an und wer genügend Geld hat, nutzt es einfach aus. Wer das Geld nicht hat, bekommt erst gar keine Chance.
Bitte nicht missverstehen: Ich will hier sicher nicht in die Kerbe der „Journalismus ist überflüssig“-Tiraden hauen. Ganz sicher nicht! Im Gegenteil: Ich wünsche mir nichts mehr als verantwortungsvollen Journalismus – wir brauchen ihn dringender auch denn je! Alles, was ich oben über Diskussionskultur geschrieben habe, war ja wirklich eine Spielwiese gegenüber den Großbränden, die wir heute überall haben. Aber das ist ein anderes Thema …
Wie können wir alldem begegnen?
Ich glaube, den aufgezählten Missständen (ja, das ist mein Wort dafür!) können wir heute nur „kleinere Öffentlichkeiten“ entgegenstellen. Bedeutet für mich: Öffentlichkeiten, die wir selbst herstellen sollten. Ich spreche von Communitys und Netzwerken. Da können wir mitbestimmen, mitreden. Bis zu einem gewissen Grad auch aussuchen, wem gegenüber wir uns wie weit öffnen wollen. Wenn ich so argumentiere, geht es natürlich um das Buchmarketing, das ich als Autorin für mich selbst betreiben möchte. Den ganz großen Traum von „Alle Welt spricht über mein Buch“, den sollten wir ganz schnell vergessen. War auch vor 40 Jahren schon der absolute Glücksfall, gar keine Frage.
Wir sollten uns klarmachen, dass wir mit dieser „kleinen Öffentlichkeit“ aus Fans und Followern tatsächlich sehr viel mehr und besser an dem noch vorhandenen Interesse an Büchern partizipieren können, als wir das beispielsweise gegenüber dem alteingesessenen Feuilleton jemals konnten und können. Das ist ein großes Plus.
Allerdings: Niemand sollte die Stille, die zum Schreiben oft so notwendig ist, noch dann verlängern, wenn das Buch schon erschienen ist. Spätestens dann sollten wir gucken, dass wir schnellstens Teil eines Netzwerks, einer Gemeinschaft sind oder werden. Laut werden, uns äußern oder vielleicht sogar „einmischen“. Uns austauschen, öffnen, auf uns aufmerksam machen, auf andere zugehen. Und selbstverständlich immer wieder auch die Bücher anderer Menschen lesen, öffentlich darauf reagieren.
So entstehen Netzwerke. Und die sind meiner Ansicht nach die einzige Chance, die wir heute noch haben, um für unsere Bücher eine größere „kleine“ Öffentlichkeit herzustellen.
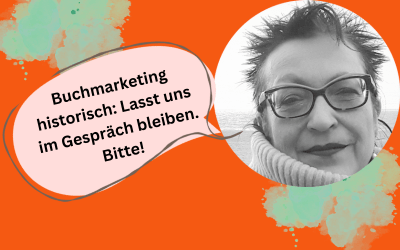
Dieser Beitrag ist Teil meiner Serie „Buchmarketing historisch“.
Und ich schreibe ihn unter anderem deshalb, weil ich jahrzehntelange Erfahrung im Buchmarkt mit all seinen Erscheinungsformen habe. Seit ich als Buchhebamme Menschen dabei unterstütze, ihr eigenes Buch – vorwiegend als Selfpublisher – zu publizieren, fiel mir auf, wie groß die Kluft ist, die zwischen Buchmarketing in Eigenverantwortung und dem früher üblichen Aufgehobensein in Verlagen und Buchhandlungen geworden ist. Ja, es war gemütlicher – gar keine Frage.
Heute müssen auch Verlagsautoren fast so viel an Buchmarketing auf die Beine stellen wie Selfpublisher. Das ist schwierig – und ich würde mich gern darum kümmern … Denn dieses „Prekariat des Buchmarketing“ ist ein unhaltbarer Zustand, finde ich. Darum arbeite ich derzeit auch mit Hochdruck an meinem ersten Selbstlernkurs: Buchmarketing jenseits von amazon wir er heißen.
Mehr demnächst hier, in diesem Theater …
Text und Bild: Maria Al-Mana, die Buchhebamme